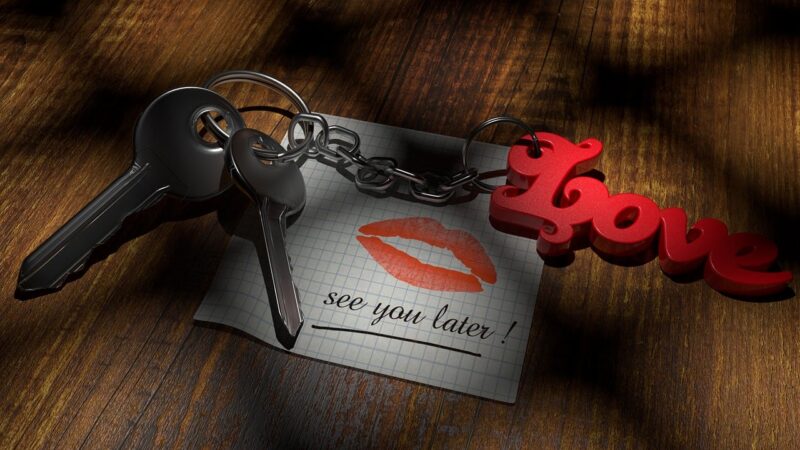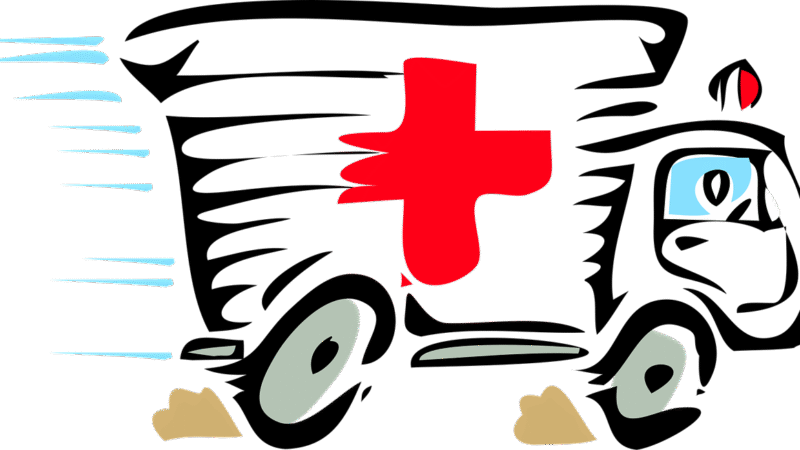Bildungsforschung in Ostdeutschland: Herausforderungen und Erfolge
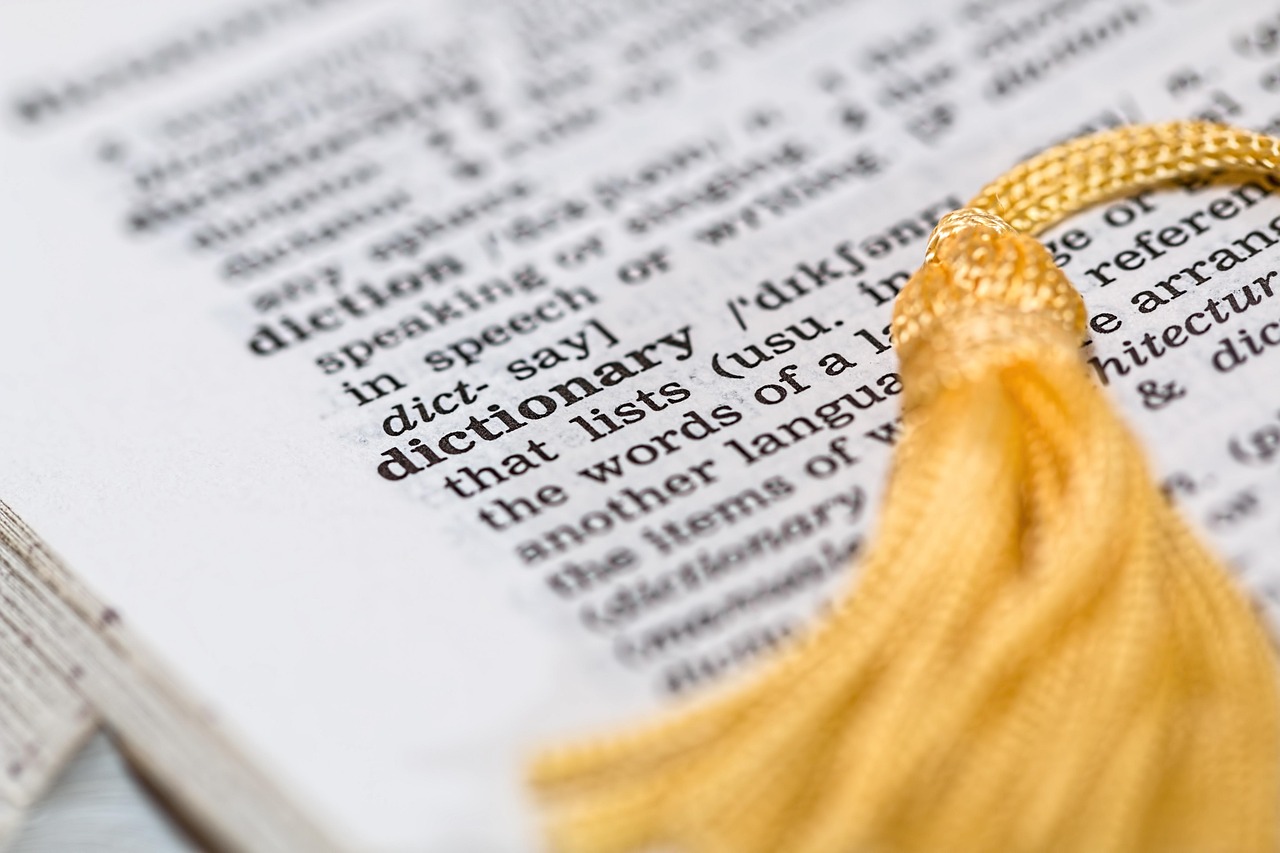
|
IN KURZFORM
|
Am 13. Oktober 2022 fand an der Universität Rostock eine Tagung zur exzellenten Bildungsforschung in Ostdeutschland statt. In der Eröffnungsrede wies Professor Wolfgang Schareck auf die ersten Irritationen zum Thema hin. Professor Axel Gehrmann thematisierte in seiner Keynote den Wandel der Bildungsforschung und die lange Vernachlässigung der Transformation des Schulsystems in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Die Studie ergab, dass Ostdeutschland 40 Prozent seiner Schüler:innen, 50 Prozent seiner Schulen und 30 Prozent seiner Lehrkräfte seit der Wende verloren hat. Zudem fand die Bildungsforschung oft nur an westdeutschen Institutionen statt, was zu einer lückenhaften Analyse der komplexen Entwicklungsprozesse führte. Die Tagung ermöglichte einen Austausch unter Wissenschaftler:innen über Themen wie Lehrer:innenkompetenzen und die Integration von Menschen mit Fluchterfahrungen. Insgesamt wurde der Fokus auf die Bedeutung der ostdeutschen Bildungsforschung und die Herausforderungen, aber auch die Erfolge in diesem Bereich gelegt.
Einleitung
Die Bildungsforschung in Ostdeutschland hat in den letzten Jahrzehnten bedeutende Herausforderungen zu bewältigen gehabt, insbesondere im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen nach der Wiedervereinigung. Dieser Artikel beleuchtet die Entwicklungen, Erfolge und gegenwärtigen Fragestellungen der Bildungsforschung in der Region. Durch die Analyse von Vorträgen und Forschungsprojekten, die auf der Tagung „Exzellente Bildungsforschung in Ostdeutschland“ in Rostock präsentiert wurden, wird ein umfassender Einblick in die aktuellen Themen und Probleme gegeben.
Die historische Perspektive der Bildungsforschung
Der Blick auf die Bildungsforschung in Ostdeutschland ist untrennbar mit der Geschichte der Region verbunden. Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 erlebte das Bildungssystem einen gewaltigen Transformationsprozess. Die Forschung zu diesen Veränderungen wurde jedoch lange Zeit vernachlässigt. Professor Axel Gehrmann wies auf der Tagung darauf hin, dass die Expertise in der Bildungsforschung oft nicht der komplexen Realität in Ostdeutschland gerecht wurde. Stattdessen war die Wissenschaft stark von westdeutschen Perspektiven geprägt, die häufig nicht die spezifischen Herausforderungen der ostdeutschen Schulen erfassten.
Aktuelle Herausforderungen in der Bildungsforschung
Lehrkräfte- und Schülermangel
Eine der zentralen Herausforderungen, die in den letzten Jahren in der ostdeutschen Bildungsforschung aufgezeigt wurde, ist der Lehrkräftemangel. Seit der Wende hat Ostdeutschland 40 Prozent seiner Schüler:innen und 30 Prozent seiner Lehrkräfte verloren. Diese Entwicklungen wirken sich direkt auf die Qualität der schulischen Bildung aus und erfordern dringend innovative Lösungen. In diesem Zusammenhang werden auch die Kompetenzen der Lehrer:innen und deren berufliche Entwicklung vermehrt in den Fokus gerückt.
Schulschließungen und deren Auswirkungen
Ein weiteres, eng mit dem Lehrkräftemangel verzahntes Problem sind die Schulschließungen. Viele ländliche Regionen in Ostdeutschland sehen sich gezwungen, Schulen zu schließen, was nicht nur einen Verlust von Lernorten bedeutet, sondern auch soziale Strukturen und das Gemeinschaftsgefühl gefährdet. Durch solche Gegebenheiten wird die Bildungsforschung nicht nur zur Analyse, sondern auch zur Entwicklung tragfähiger Konzepte gefordert, um die Bildungslandschaft in Ostdeutschland zu stabilisieren und zu erneuern.
Erfolge der Bildungsforschung in Ostdeutschland
Trotz der Herausforderungen gibt es auch erfreuliche Entwicklungen in der ostdeutschen Bildungsforschung. In den letzten Jahren hat sich eine breite und vielfältige Forschungsgemeinschaft etabliert, die sich aktiv mit den Besonderheiten des ostdeutschen Bildungssystems auseinandersetzt.
Netzwerke und Kooperationen
Eine der positiven Entwicklungen ist die Schaffung von Netzwerken und Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis. Die Tagung in Rostock hat gezeigt, dass viele Institutionen bereit sind, im Bereich der Bildungsforschung zusammenzuarbeiten und Erfahrungen auszutauschen. Solche Ansätze fördern nicht nur die Vernetzung von Expert:innen, sondern auch den Wissenstransfer in die Schulen.
Forschungsprojekte und ihre Relevanz
Eine Vielzahl von innovativen Forschungsprojekten befasst sich intensiv mit den Themen, die für die Schulen in Ostdeutschland von Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem die Kompetenzen von Lehrer:innen, der Studienerfolg im Lehrerberuf sowie der (Wieder-)Einstieg von Personen mit Fluchterfahrungen in das Bildungssystem. Diese Projekte sind nicht nur akademischer Natur, sondern haben auch reale Auswirkungen auf die Gestaltung des Unterrichts und die Unterstützung von Lehrenden und Lernenden.
Die Rolle der politischen Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen, die von der Politik festgelegt werden, spielen eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Bildungsforschung. In jüngster Zeit hat es Bestrebungen gegeben, die Forschung zu stärken und durch gezielte Förderung zu unterstützen. Wichtige Programme und Initiativen, wie sie zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung angekündigt wurden, gewährleisten eine nachhaltige Unterstützung der Bildungsforschung, die auch zur Stärkung der Bildungslandschaft in Ostdeutschland beiträgt.
Ausblick: Zukünftige Entwicklungen
Ein Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten in der Bildungsforschung in Ostdeutschland zeigt, dass die Notwendigkeit für kontinuierliche Forschung und Anpassung an neue gesellschaftliche Gegebenheiten unabdingbar ist. Insbesondere die Integration von Digitalisierung und die Auseinandersetzung mit neuen Lehr- und Lernmethoden werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen.
Bildung und soziale Gerechtigkeit
Ein weiterer zentraler Aspekt wird die Frage der sozialen Gerechtigkeit im Bildungsbereich sein. Durch die tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen sind neue Ansätze notwendig, um Chancengleichheit für alle Schüler:innen sicherzustellen. Forschungsprojekte, die sich mit diesen Themen beschäftigen, werden zukünftig eine essenzielle Rolle spielen.
Internationale Vergleiche
Überregionale und internationale Vergleiche könnten ebenfalls dazu beitragen, das Bildungssystem in Ostdeutschland weiterzuentwickeln. Der Austausch von Erkenntnissen und bewährten Praktiken aus anderen Ländern kann wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Ostdeutschen Bildungslandschaft geben. Konferenzen und Workshops, die sich mit internationalen Bildungsfragen befassen, fördern diesen Prozess.
Fazit
Die Bedeutung der Bildungsforschung in Ostdeutschland ist heute unbestreitbar. Die Region hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und ihre spezifischen Herausforderungen aktiv angegangen. Durch eine gezielte Forschungsagenda, die Entwicklung von Netzwerken sowie die Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Fragestellungen kann die ostdeutsche Bildungsforschung auch in Zukunft erfolgreich wirken.
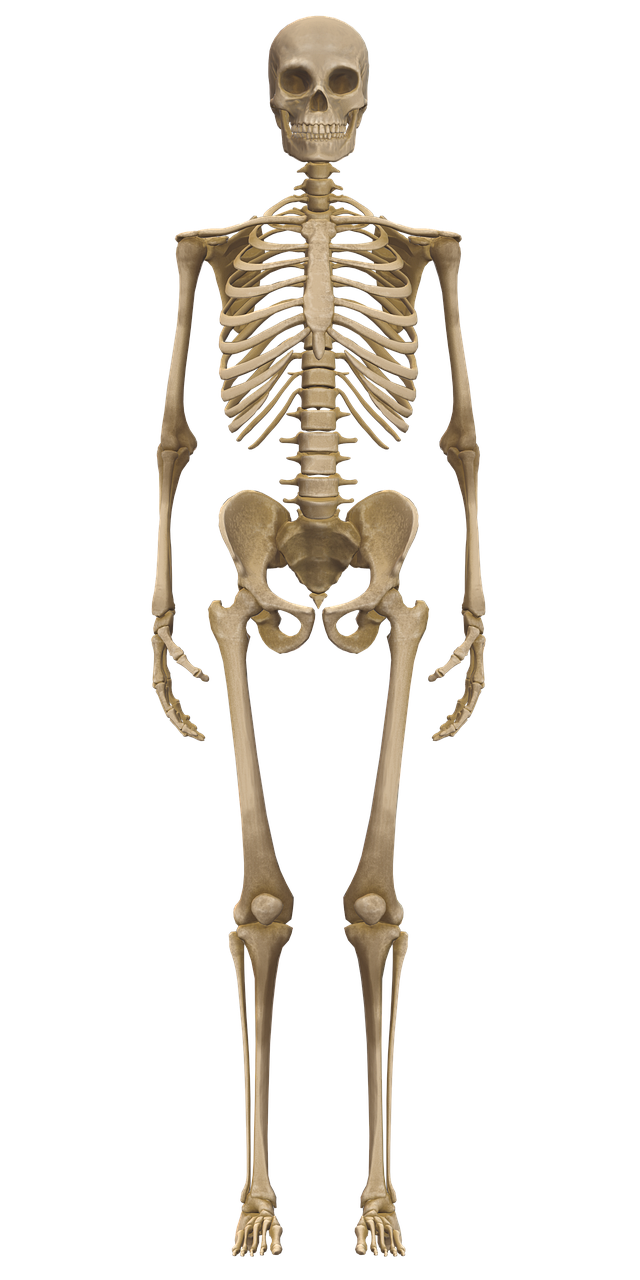
Die Bildungsforschung in Ostdeutschland sieht sich einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber. Bei der Tagung an der Universität Rostock wurde die Frage aufgeworfen, ob wir bereits über exzellente Bildungsforschung verfügen oder ob wir erst auf dem Weg dorthin sind. Professor Wolfgang Schareck, der Rektor der Universität Rostock, verdeutlichte in seiner Eröffnungsrede, dass der Titel der Konferenz zunächst für Irritation sorgte, was die unterschiedliche Wahrnehmung der Bildungsforschung betrifft.
Ein zentrales Thema der Tagung war der Wandel der ostdeutschen Bildungsforschung, was Professor Axel Gehrmann in seiner Keynote herausstellte. Er betonte, dass die Forschung zur Transformation des Schulsystems nach der Wiedervereinigung lange Zeit vernachlässigt wurde. Besonders auffällig war, dass die Theorie zur formalen Bildung in gesellschaftlichen Transformationsprozessen häufig fehlte. Dies führte dazu, dass die Lehrkräftebildung ebenfalls lange Zeit unbeachtet blieb, was zu den heutigen Herausforderungen führt.
Die Statistiken, die Gehrmann vorlegte, waren alarmierend. Ostdeutschland hat seit der Wende 40 Prozent seiner Schüler:innen, 50 Prozent seiner Schulen und 30 Prozent seiner Lehrkräfte verloren. Diese Zahlen werfen ein Licht auf die Dringlichkeit von Veränderungen im Bildungsbereich. Seit zwei Jahrzehnten wird altbekannte Themen nicht mehr diskutiert, während andere im Vordergrund stehen.
Die Tagung bot jedoch auch einen Raum für Erfolge in der Bildungsforschung. 14 Wissenschaftler:innen berichteten über aktuelle Forschungsprojekte in Ostdeutschland, die Themen von Lehrer:innenkompetenzen bis zum (Wieder-)Einstieg von geflüchteten Menschen abdeckten. Diese Vielfalt in den Projekten zeigt das Potenzial der Bildungsforschung, relevante Lösungen zu finden und die Praxis nachhaltig zu unterstützen.
In einem weiteren Beitrag diskutierten Professorin Nina Kolleck und Lea Fobel die Analyseperspektive „Ostdeutschland“ und dessen Relevanz für die Forschung im Bereich non-formaler kultureller Bildung. Diese Diskussion beleuchtet die Bedeutung des regionalen Kontextes bei der Analyse von Bildungsfragen und zeigt, dass empirische Forschung in diesen Bereichen notwendig ist.
Insgesamt hat die Tagung nicht nur den Austausch zwischen Wissenschaftler:innen gefördert, sondern auch ein Netzwerk geschaffen, das die Bildungsforschung in Ostdeutschland aktiv unterstützt. Der persönliche Austausch in Präsenz ermöglichte vertiefte Diskussionen und Ideen, die in der Zukunft zur Lösung bestehender Herausforderungen beitragen können.